 Erster Satz: Zuerst die Farben.
Erster Satz: Zuerst die Farben.
1939 in Molching, einer kleinen Stadt bei München: Liesel Meminger verabschiedet sich von ihrer Mutter und wird ihren neuen Pflegeeltern, den Hubermanns, übergeben. Auf der Zugfahrt hierher ist ihr kleiner Bruder gestorben und nach seiner Beerdigung hat sie bereits ihr erstes Buch gestohlen.
Die Jahreszahl und Liesels ungewöhnliches Schicksal sprechen für sich. In diesem Buch geht es um Krieg, um Kindheit, um Ungerechtigkeit und um die Liebe zum Wort. Liesels Pflegemutter ist grob, aber herzlich, ihr Pflegevater ein ruhiger, aber grundanständiger, weiser Mann, der ihr nachts das Lesen beibringt und nachdem sie mit ihrem Nachbarn und Diebstahlpartner Rudi Freundschaft geschlossen hat und in die Fußballmannschaft aufgenommen wird, scheint alles gut.
Aber dann beginnen die Hubermanns einen Juden in ihrem Keller zu verstecken, Rudi wird bei der Hitlerjugend von Älteren gemobbt, die ersten Bomben schlagen ein und Liesel muss unbedingt ein neues Buch stehlen.
Das Besondere an diesem Buch ist, dass der Erzähler der Tod ist. Er nimmt deshalb gern vorweg, wer wie stirbt, doch das tut der Geschichte erstaunlicherweise überhaupt keinen Abbruch. Im Gegenteil, auch so sind bei mir genug Tränen geflossen. Die charismatischen Figuren und der grandiose Stil haben mich sofort in ihren Bann gezogen. Ich liebe diese Sprache, mein Lieblingszitat ist: „Die Worte waren bereits zu ihr unterwegs, und als sie ankamen, hielt Liesel sie wie Wolken in den Händen und wrang sie aus bis auf den letzten Tropfen.“ (S.91). Einfach wunderschön.
Ich habe das Buch in eineinhalb Tagen ausgelesen und am zweiten Tag konnte ich es nicht liegen lassen, während ich mir etwas zu essen machte und habe beim Lesen prompt das Salz im Wasser vergessen und die Nudeln komplett zerkocht. Gottseidank gab’s dazu Soße aus dem Glas, nicht auszudenken, was da hätte schief gehen können.
Ein wirklich zauberhaftes Buch. Im Gegensatz zu vielen anderen Geschichten, die im 2. Weltkrieg spielen, gibt es hier keinen Zeigefinger, obwohl der Tod seufzt, dass es viel zu viel Arbeit gab, da es quasi aus seiner „neutralen“ 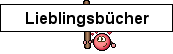 Sicht, gepaart mit dem naiven Blick eines Kindes, erzählt wird. Dennoch, oder vielleicht auch genau deshalb, schnürt die Ungerechtigkeit, der man ausgeliefert war, dem Leser die Kehle zu.
Sicht, gepaart mit dem naiven Blick eines Kindes, erzählt wird. Dennoch, oder vielleicht auch genau deshalb, schnürt die Ungerechtigkeit, der man ausgeliefert war, dem Leser die Kehle zu.
Unbedingt lesen.

